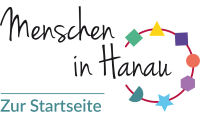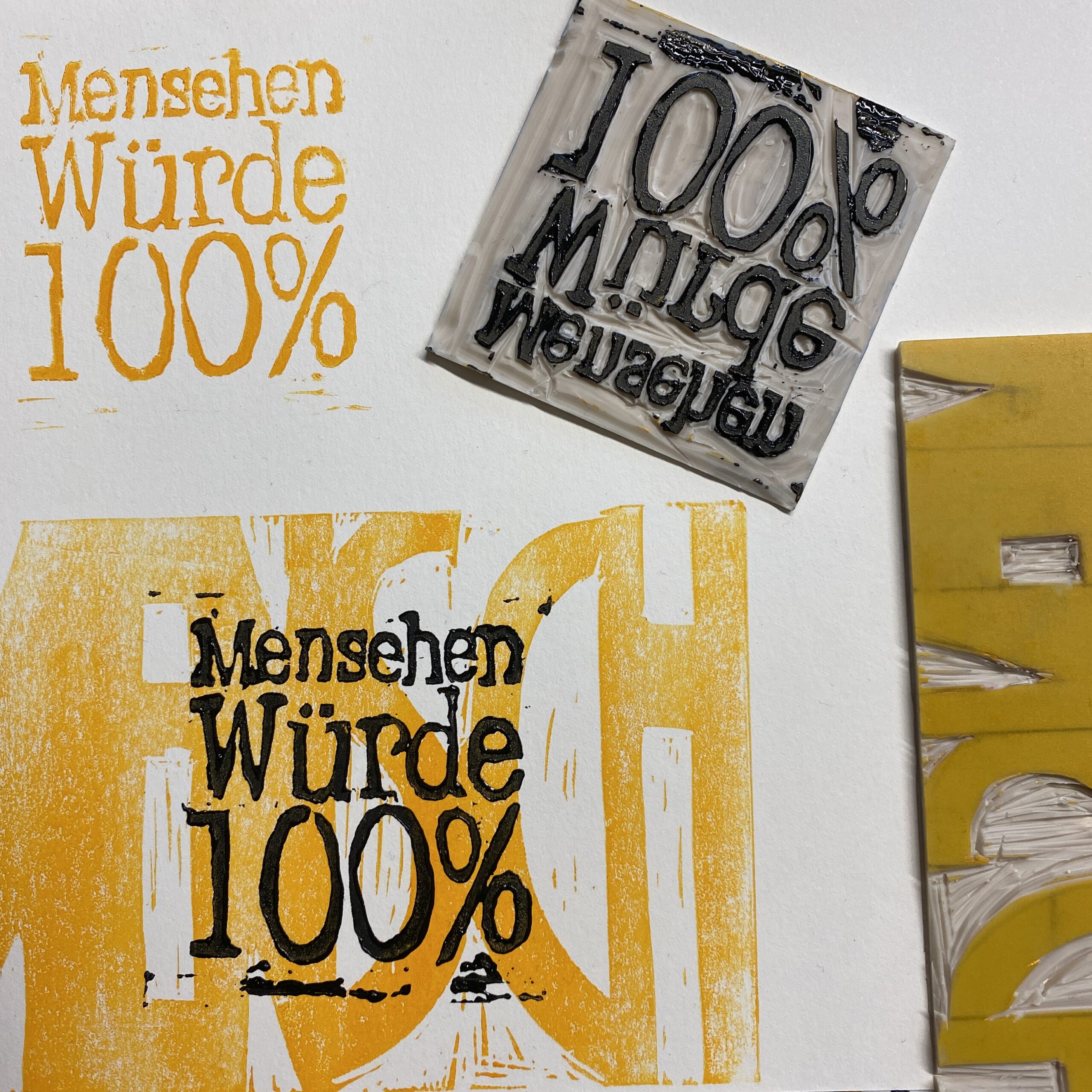Autismus zählt zu den sogenannten tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, ist angeboren und besteht ein Leben lang. Unser Mitglied Markus Behrendt, selbst Autist, erzählt uns in diesem Beitrag mehr von diesem vielschichtigen Thema:
Früher unterteilte man Autismus in mehrere Untergruppen, etwa den frühkindlichen Autismus, das Asperger-Syndrom oder den atypischen Autismus. Heute weiß man, dass es sich um ein mehrdimensionales, also vielschichtiges Spektrum handelt. Daher spricht man inzwischen vom Autismus-Spektrum.
Menschen im Spektrum können sehr verschieden sein. Sie unterscheiden sich mindestens genauso in ihren Persönlichkeiten, ihrer Intelligenz, ihren Vorlieben und Abneigungen wie alle anderen Menschen. Gemeinsamkeiten zeigen sich bei Autist*innen in den folgenden drei Bereichen. Diese gelten als Diagnosekriterien:
Besonderheiten bei der sensorischen Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung
Das bedeutet, dass Sinneseindrücke wie Sehen, Hören, der Tastsinn etc. anders empfunden werden als bei der Mehrheit der Menschen. Einige Sinneseindrücke können viel stärker wahrgenommen werden, andere dagegen schwächer oder auch gar nicht. In der Folge ist es autistischen Menschen beispielsweise oft zu laut oder zu wuselig, was sie sehr stresst. Einige Autist*innen vermeiden Körperkontakt. Andere, insbesondere wenn es noch Kinder sind, suchen ihn regelrecht, sogar mit fremden Personen. Dann spricht man von Distanzlosigkeit. Manche empfinden keinen Schmerz oder können diesen Sinneseindruck nicht zuordnen. Gleichzeitig werden schon leichte Berührungen der Haut als unerträglich wahrgenommen. Insgesamt nehmen autistische Menschen mehr Details wahr, haben im Gegenzug aber Schwierigkeiten, das große Ganze zu erfassen. Verständlich, denn es ist ein Unterschied, ob man, bezogen auf die Detailwahrnehmung, ein Puzzle mit 12 Teilen vor sich liegen hat, oder eins mit 500 Teilen.
Besonderheiten bei der sozialen Interaktion und Kommunikation
Autistische Menschen kommen auf die Welt ohne die sonst übliche Grundausstattung für soziales Lernen. Für sie sind Dinge und Menschen zunächst die selbe gedankliche Kategorie und werden auch im selben Hirnareal verarbeitet. Irgendwann folgt die Erkenntnis, dass Menschen eigenen Regeln folgen und nicht Naturgesetzen, so wie die Dinge um uns herum. Erst danach beginnt das soziale Lernen, was aber bedeutet, dass all das, was andere automatisch lernen und unterbewusst anwenden, bewusst beobachtet, gedanklich verarbeitet und nachgeahmt werden muss. Da menschliches Verhalten sehr komplex ist und sich mit dem Älterwerden auch verändert, handelt es sich um eine unvorstellbar große Aufgabe. Sie erfordert viele, viele, viele Jahre der Beobachtung, des Ausprobierens und der Übung. Dadurch bleibt man als autistischer Mensch in der sozialen Entwicklung um mehrere Jahre zurück. Auf Außenstehende wirkt das dann so: Mimik, Gestik und Blickkontakt entsprechen nicht dem, wie sich die Mehrheit der Menschen im jeweiligen Alter verhält. So kann Blickkontakt von einem Gegenüber als flüchtig, aber auch als viel zu intensiv empfunden werden. Ebenso wird die Sprache häufig anders genutzt: sehr viel direkter, sachbezogener und mit wortwörtlichem Verständnis. Dabei kommen manche Autist*innen aus dem Reden nicht heraus, während andere wortkarg sind oder gar nicht sprechen (können). Letzteres betrifft etwa 3 % der Menschen im Spektrum.
Eingeschränkte Interessen und Verhaltensweisen
Autistische Menschen interessieren sich häufig für ganz bestimmte Themen. Diese geben ihnen Sicherheit, damit fühlen sie sich wohl. Je nach Ausprägung spricht man von einem Spezialinteresse, also einem Interesse, das an Umfang und Intensität viel Raum und Zeit einnehmen kann. Diese Interessen müssen nicht unbedingt altersgerecht sein. So kann sich ein autistisches Kind bereits für forensische Entomologie (die Erforschung von Insekten) interessieren, während sich ein autistischer Erwachsener gerne Kindersendungen anschaut. Dazu sind Regeln sehr wichtig, denn damit wird die Umwelt, die häufig als chaotisch und unvorhersehbar erlebt wird (vgl. Detailwahrnehmung), planbarer und sicherer. Das kann dazu führen, dass die Einhaltung einer bestehenden Regel selbst dann eingefordert wird, wenn sie nicht zur jeweiligen Situation passt. Die Gründe dafür können vielfältig sein, haben aber nur von außen betrachtet mit eingeschränkten Verhaltensweisen zu tun.
Im Laufe der Zeit erlernen einige Menschen im Spektrum so gute Kompensationsstrategien, dass sie Außenstehenden nicht mehr auffallen – zumindest für einen gewissen Zeitraum. Denn Kompensation kostet Energie und diese ist begrenzt. So bliebt der menschliche Kontakt, der so viele Jahre mühsam wie eine fremde Sprache in einer fremden Kultur erlernt werden musste, lebenslang eine bewusste Denkaufgabe. Das ist sehr anstrengend. Deshalb brauchen selbst kontaktfreudige Autist*innen regelmäßig Zeit für sich, ohne andere Menschen um sich herum. Das gleiche betrifft auch die sensorische Wahrnehmung, wo ein Zuviel (Menge und Intensität der Sinnesreize) ebenfalls regelmäßige Erholung erfordert.
Da bestimmte Situationen, Strukturen und Abläufe in unserer Gesellschaft (noch) nicht autismusfreundlich sind, stoßen einige Autist*innen schon im Kindes- und Jugendalter an ihre Grenzen und erfahren Ablehnung. Dadurch und aufgrund der hohen Anpassungsleistung können sie psychische Erkrankungen entwickeln, etwa Ängste, Zwänge, Tics, Essstörungen oder eine Depression bis hin zu Suizidalität. Auch Co-Diagnosen sind gängig, etwa ein Aufmerksamkeitsdefizit mit oder ohne Hyperaktivität (ADHS/ADS) oder eine Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS).. Manche autistischen Menschen haben zusätzlich auch Epilepsie.
Soweit eine verkürzte Darstellung des Autismus-Spektrums. Es handelt sich weder um eine Modediagnose, noch um eine Frage der Erziehung oder der Anwendung einer bestimmten Therapie. Autismus hat man sein Leben lang. Heilung ist nach derzeitigem Wissensstand nicht möglich. Geeignete (geeignete!) Maßnahmen können aber helfen, sich selbst besser kennenzulernen, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln, die Selbstsicherheit zu stärken und besser mit Problemen des Alltags umzugehen. Sinnvollerweise wird das Umfeld mit einbezogen, denn eine Annäherung der verschiedenen Lebensrealitäten und das Lernen voneinander kann nur wechselseitig erfolgen bzw. verspricht dann einen größeren Erfolg.
Sind die Rahmenbedingungen gut, können viele autistische Menschen ein glückliches und ihren jeweiligen Möglichkeiten entsprechend selbstbestimmtes Leben führen.
Text von Markus Behrendt
Habt ihr Interesse mehr von Markus und von dem Thema Autismus zu erfahren?
Am 24. Mai hält Markus in Schlüchtern einen Vortrag zum Thema „Autismus und Suizidalität“. Dabei wird es sowohl allgemein um Suizidalität gehen als auch spezifisch um die Frage, warum Menschen im Autismus-Spektrum häufiger davon betroffen sind. Es wird eine vielschichtige Veranstaltung mit Erfahrungen aus seiner Arbeit mit autistischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, gepaart mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und eigenen Erfahrungen mit Suizidalität als autistischer Mensch. Nicht zu kurz kommen auch mögliche Lösungsansätze, die Mut machen und Zuversicht spenden. Im Anschluss an den Vortrag und einer kurzen Pause wird Markus sich auch noch viel Zeit für Fragen nehmen.
Veranstalterin ist die Selbsthilfegruppe Autismus im Main-Kinzig-Kreis und weitere Infos findet ihr auch hier. Eine Anmeldung ist erforderlich und die Teilnahme ist kostenfrei.