„Die Corona-Krise hat dieses Jahr die ganze Welt erschüttert und seit Mitte März auch das Leben in unserer Gemeinde verändert und massiv eingeschränkt. Ich erinnere mich an folgenden Tag: Es ist Freitag, der 13. März. Meine Kollegin und ich betreuen ein offenes Gesprächsangebot für Menschen, die über den rassistischen Terroranschlag vom 19. Februar sprechen möchten.
Am selben Morgen werde ich Zeugin, wie ein Mann meine Kollegin an der Information rassistisch beleidigt. Ich schreite ein. Der Mann geht weg. Die Kollegin und ich sind fassungslos.
Ich trage an diesem Tag schwarz, weil ich immer noch nicht fassen kann was diesen jungen Menschen und ihren Familien wiederfahren ist. Weil ich keine Farben ertragen kann. Weil ich seit diesem Moment das tägliche Leben kaum noch ertragen kann und ich mir gar nicht ausmalen möchte, wie es den Angehörigen und Freund*innen der Opfer gehen muss.
Ferhat Unvar, Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi und Fatih Saracoglu wurden aus dem Leben gerissen.
Meine Kollegin und ich sitzen zusammen. Niemand kommt an diesem Tag, um mit uns zu sprechen und ich bin irgendwie erleichtert, weil ich nicht weiß, ob ich die Kraft gehabt hätte, jemanden zu unterstützen oder zu trösten. Gegen 16:45 Uhr kommt plötzlich eine Durchsage, in der bekannt gegeben wird, dass das unsere Einrichtung in wenigen Minuten auf unbestimmte Zeit schließen wird. Mir wird merkwürdig zu Mute.
- Rassismus.
- Terror-Attentat.
- Pandemie.
- Ausgangssperre.
Vier Monate später
Am 02.07.2020, um 19.00 Uhr lädt die Initiative „Menschen in Hanau“ zu einer Diskussion ein. Bei diesem Austausch soll es um die Frage gehen: Warum schaffen wir einen sichtbaren Zusammenhalt oder ein „Wir“-Gefühl nur bei Extrem-Ereignissen, wie der Pandemie oder dem Anschlag vom 19.02.2020 in Hanau?
Ich bin mir anfänglich nicht sicher, ob man diese beiden Ereignisse in eine Beziehung setzen kann, aber ich kann nicht von der Hand weisen, dass diese Ereignisse zeitgleich passieren. Sich gegenseitig beeinflussen. Vor allem die Menschen beeinflussen, die unmittelbar von der Tat betroffen sind. Die in ihrer Trauer gestört werden. Die auf Distanz gehen sollen und sich nicht mehr treffen sollen, wo doch Nähe so wichtig ist und Isolation pures Gift.
Der Zusammenhang ist vielleicht doch da.
Es sind extreme Situationen.
Die Diskussion
Wir treffen uns also am 02.07. im Garten mit 1,5 m Abstand zur Diskussion.
Wir steigen in die Diskussion mit einem Artikel aus der Frankfurter Rundschau ein, in dem die Corona Situation, sagen wir mal, leicht romantisiert wird, oder, „das Positive“ an der Situation hervorgehoben wird. Der Autor argumentiert, dass die Unruhe zurück ist, während die Ruhe durch die Einschränkungen durch Corona eigentlich schön war. Ein Vergleich der „vor Corona-Situation“, der „Während Lock-Down-Situation“ und „nach der Lockerung-Situation“.
Vor Corona: Stress – die Angst, etwas zu verpassen – lautes und hektisches Leben.
Während, beziehungsweise durch Corona: Ruhe – Stillstand des Konsums – Rücksichtnahme.
Innerlich stimme ich dem Autor insofern zu, dass vor allem Selbstisolation jetzt möglich war, ohne eine Ausrede zu benötigen.
Anstatt weit zu reisen, begannen viele Menschen die Natur in der Nähe und die eigene Umgebung zu entdecken. Der Händedruck ist plötzlich ein Tabu und auch reduzieren sich im Alltag ungewollte Berührungen durch die Abstandsregel.
Wir sammeln positive Aspekte und Stichwörter:
- Digitalisierung – es wurde deutlich, dass in diesem Bereich viel getan werden muss und Digitalisierung viele Chancen und Alternativen bedeutet.
- Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit auf ein Arbeiten im Homeoffice.
- Menschen wachsen über sich hinaus und übernehmen Verantwortung für andere Menschen, gehen für sie einkaufen oder kümmern sich um sie, es wurde mehr gespendet als in anderen Zeiten.
- Durch die Tönnies-Situation wurden die Massentierhaltung und der Konsum von Billigfleisch thematisiert und Veganismus erscheint auf einmal als interessante Alternative.
- Der Tönnies Skandal und die Grenzschließung stellen aber auch die Ausbeutung und den Bedarf an Arbeiter*innen aus anderen EU-Ländern in den Mittelpunkt.
Eine Person aus der Diskussionsrunde hofft, dass wir diese Themen und die Veränderungen weiter mitnehmen können auch „nach Corona“. Eine andere Person wirft ein, dass es kein Leben „nach Corona“ geben wird, sondern nur ein Leben „mit Corona“. Das „danach“ ist eine Illusion. Ob wir wollen oder nicht, das Leben wie es vorher war ist passé.
Nur von kurzer Dauer?
Wir diskutieren sehr schnell darüber, dass wir befürchten, dass es dennoch nur kurze Effekte und Momente sind, die schnell abebben werden, da sich die Menschen scheinbar ihr altes Leben zurückwünschen. Die Frage tritt auf, wie nachhaltiges Denken und nachhaltige Veränderungen erreicht werden können? Und das, nicht nur bezogen auf die Corona-Krise, sondern ebenso bezüglich unseres eigenen Traumas, durch das terroristische Attentat hier in Hanau.
Kann man daraus auch positive Veränderungen gewinnen?
Es wird für einen Moment still. Die meisten von uns schauen auf den Boden. Es ist mir unangenehm, das Wort „positiv“ in einem Satz mit dem Attentat zu nennen. Vielleicht eher nachhaltig?
Nachhaltige Veränderungen
Wie können wir nachhaltige Veränderungen schaffen, aus diesem Trauma, die den Rassismus in Deutschland beenden werden?
Wenn ich ehrlich bin, wirkt Hanau auf mich nicht, wie das Ende dieses Hasses. Persönlich habe ich die Befürchtung, dass Hanau nicht das letzte Attentat gewesen sein wird, aber diese Sorge behalte ich in diesem Moment für mich.
Wir sprechen darüber, dass unsere Regierung sehr langsam aus ihrem Dornröschen-Schlaf bezüglich der rechten Bedrohung erwacht. Selbst Horst Seehofer, Innenminister und Erfinder des Heimatministeriums, hat mittlerweile verlauten lassen, er sehe Rechtsradikalismus als die größte Bedrohung für unseren Staat. Ziemlich zynisch, wenn man bedenkt, dass er vor 2 Jahren noch Migration als „Mutter aller Probleme“ benannt und sich mit vielen anderen unrühmlichen, islamfeindlichen Aussagen als „Scharfmacher“ betätigt hat. Aber jeder Mensch darf seine Meinung ändern und ich begrüße es sehr, dass Seehofer nun anders spricht. Manchmal mehr, manchmal weniger.
Jetzt, da bekannt wurde, dass rechte Netzwerke eine Liste von Namen, Adressen und Telefonnummern bekannter Politiker*innen – eine Todesliste – zusammengestellt habe, muss das Problem ernstgenommen werden.
Wieder eine Krise, die zu einer Veränderung führen muss, bevor wir noch mehr Politiker*innen beerdigen müssen. Für Walter Lübcke kommt diese Einsicht leider zu spät.
Wir fragen uns:
Warum sind Extremsituationen nötig, um Menschen zum Nachdenken zu bringen?
Warum sind wir erst dann für Veränderungen bereit?
Warum nur bei negativen Impulsen?
Das Thema Berichterstattung kommt auf. „Bad news is good news.” (Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten). Diese Mentalität wird von der Presse unterstützt. Vor allem, wenn wir bedenken, welche Zeitung, die meist verkaufte Zeitung in Deutschland ist …
Wir fragen uns:
Ist es wirklich so, dass es unser Bedürfnis ist, nur schlimme, schlechte Sachen zu lesen?
Wollen wir „Deutschen“ nur Tragödien hören?
Immer nur negativ?
Warum sind viele Menschen so sensationsgeil und voyeuristisch veranlagt?
Zum Beispiel, denken wir daran, welchen Aufwand die Polizei betreiben muss, um Gaffer an Unfallstellen davon abzuhalten, Fotos zu machen.
Wir merken, dass wir uns in unserer Diskussion schon wieder zu stark auf die negativen Dinge konzentrieren. Es fällt schwer, positive Dinge zu benennen.
Wir fragen uns:
Wie können wir Positives herausfiltern?
Was können wir aus dem Anschlag in unserer Gemeinde mitnehmen?
Eine Person in unserer Gruppe hat den Mut auszusprechen, was ich denke, nämlich, dass sie das Positive nicht benennen kann. Vielleicht jetzt noch nicht. Vielleicht nie. Vielleicht wird es sich erst nach Jahren zeigen. Vielleicht muss man erst aktiver werden. Vielleicht müssen sich Dinge erst wirklich nachhaltig verändern.
Der Rassismus ist allgegenwärtig und vielleicht können wir beide nichts Positives sehen, weil wir wissen, wie es sich anfühlt. Nicht erst seit dem 19. Februar. Wir versuchen es noch einmal.
Ist es dieses Mal anders?
Ich zwinge mich dazu, Steinmeiers Rede an der Trauerfeier hervorzuheben. Ich habe wirklich noch nie einen Politiker so klar Farbe bekennen hören. „Tacheles“: Die weiße, deutsche Mehrheitsgesellschaft muss Rassismus nicht erfahren haben, um sich solidarisch zu zeigen.
Solidarität.
Mitgefühl.

Eine Person hebt hervor, dass viele Menschen Mitgefühl gezeigt haben. Vor allem an den Gedenkstätten an den Tagen, an denen gemeinsam getrauert wurde. An den Tagen, an denen man gemeinsam trauern konnte. Das politische Momentum, die Demonstrationen, die Aktivist*innen und Menschen in unserer Gemeinde, die sich für die Opferfamilien einsetzen.
Die Stärke, die die Angehörigen zeigen, wenn sie an die Öffentlichkeit treten. Das ist wirklich inspirierend.
Aber leider erinnere ich mich auch daran, dass es viele Menschen gab, die kein Mitgefühl gezeigt haben. Dass man es in manchen Nachbargemeinden nicht für nötig hielt, den Karneval abzusagen. Ich viele Leute kenne, die wochenlang ein „Je suis Charlie“ Profilbild auf Facebook hatten, aber über Hanau kein Wort der Anteilnahme verloren haben. Deren Schweigen sich in mein Herz schneidet wie ein scharfes Messer und ich keine Kraft habe, diese Menschen mit ihrer Ignoranz zu konfrontieren. Aber ich behalte das in diesem Moment für mich. Wir wollen ja positiv bleiben.
Wie kann das Mitgefühl gestärkt werden?
Eine Person merkt an, dass sie Rassismus-Erfahrungen nicht so sehr nachzuvollziehen kann, da sie nie selbst welche gemacht hat, aber sich selbst kritisch hinterfragt. Nach innen schaut und fragt: Wo ist mein innerer Rassismus? Wo habe ich selbst rassistische und voreingenommene Denkmuster? Wie ist meine Position? Wie kann ich mein Verhalten aufbrechen? Meinen inneren Kompass finden?
Ich bin beeindruckt. Und ich wünschte mir, alle Menschen wären so mutig, sich und die eigenen Denkmuster zu hinterfragen. Denn nur auf diesem Weg werden wir zu echten Veränderungen kommen. Solange weiße Menschen defensiv auf das Thema Rassismus reagieren, werden wir nicht zusammenkommen, sondern uns weiter voneinander entfernen.
Wie können wir also zu einem Dialog einladen, ohne dass die inneren Mauern hochgehen?
Eine Teilnehmerin betont, dass es diese Reflexionsebene gerade bei denen geben müsse, die sich klar als Anti-Rassisten definieren und sich engagieren. Zum Beispiel bei der Organisation der Wochen gegen Rassismus: Es entstünde oft der Eindruck, es werden die Wochen „für“ nicht „mit“ den Kulturvereinen oder Interessenvertretungen von multikulturellen Einrichtungen gemacht. Zu wenig seien BPoC (Black People of Color – Schwarze und andere Menschen of color) bei der Organisation vertreten. Die Zusammenarbeit mit kulturellen Gruppen sei fast nicht existent.
Es wird sehr schnell klar: Wir müssen ernsthaft an Begegnungen arbeiten.
Wir versuchen uns wieder auf das „Positive“ zu konzentrieren, auf die Offenheit für Dialog und Begegnung, die spürbar war.
Erinnerungskultur
Wir beginnen eine Diskussion darüber, wie mit der Erinnerung umgegangen werden kann. Dass die Bedürfnisse der Angehörigen im Mittelpunkt stehen müssen, darin waren sich alle Diskutierenden einig. Dass es mehr als ein Ort geben muss, an dem man sich erinnern kann, treffen kann, trauern kann, ebenfalls.
Kesselstadt muss in den Mittelpunkt gerückt werden. Das Viertel um den Kurt Schuhmacher Platz könnte verändert werden in Zusammenarbeit mit den Menschen, die dort leben.
Es wird klar, dass wir uns auch eine zentrale Gedenkstätte, die für alle sichtbar, auf dem Marktplatz wünschen.
Wir sprechen darüber, dass diese Frage nach dem Gedenken Teile der Bevölkerung zu spalten scheint. Es gäbe sogar schon Stimmen, die verlauten lassen würden, mit den Blumen am Brüder-Grimm-Denkmal wäre es jetzt auch langsam mal genug. Ich explodiere innerlich. Wie herzlos und spießig kann man sein?
Tief durchatmen. Zurück zum Positiven? Ich weiß nicht. Weiter daran arbeiten, positiv zu bleiben und eine Weiterarbeit zu erreichen und ein „Wir“ zu erhalten?

Was gibt uns ein „Wir-Gefühl“?
Jemand bringt den Begriff „Wir-Gefühl“ auf, mit dem Verweis auf den Sommer der WM. Deutschland – Das Sommermärchen. Aber das war doch was ganz Anderes. Euphorie war dort das verbindende Element und nicht Angst und Trauer. Eine Schicksalsgemeinschaft.
Bei Corona reden viele davon „Das Virus macht alle gleich“, denn das Virus diskriminiere nicht.
Da sind wir uns nicht wirklich einig. Vor allem, bei dem Blick in die USA, wo das „Gesundheitssystem“ (ja, es muss wirklich in Gänsefüßchen gesetzt werden) ganz klar eine soziale Zäsur darstellt. Während wir in Deutschland über die unterschiedliche Behandlung von Privat- und Kassenpatienten streiten, haben in den USA sehr viele Menschen keine Krankenversicherung, da sie es sich nicht leisten können. Und selbst jene, die eine Versicherung haben, zahlen hohe „Co-Pays“ – Eigenbeiträge.
Auch das Virus und die damit verbundenen Maßnahmen haben uns nur kurzeitig zusammengeführt. Man denke nur an Corona-Leugner und Masken-Gegner. Die Rücksichtnahme war von kurzer Dauer.
Warum?
Vermutlich weil Rücksichtnahme anstrengend ist. Menschen sind dadurch gezwungen, sich mit den Bedürfnissen anderer auseinanderzusetzen. Gezwungen das eigene Ego und das eigene Lust-Prinzip, nach dem Motto „Ich will aber …“, zurückzustellen.
Was können wir tun?
Wie kann Empathie also gefördert werden? Wir einigen uns darauf, daran zu arbeiten, Sachverhalte in einen Zusammenhang zu bringen. Bezüge herzustellen. Um es Menschen leichter zu machen, die Erfahrungen anderer nachvollziehen zu können.
- Wir wollen Lesungen zum Thema Sprache und Rassismus veranstalten und versuchen zu analysieren, wie sich solche Weltbilder zusammensetzen.
- Geschichten dekonstruieren, um historische Perspektiven zu hinterfragen.
- Politik, Zivilgesellschaft, engagierte Personen an einen Tisch bekommen.
- Voneinander lernen und Prozesse verstehen und hinterfragen.
Wir brauchen Diskussionen und Diskurse in unserer Gesellschaft, die uns nicht weiter voneinander entfernen, sondern die uns zusammenführen und unser Verständnis füreinander schärfen.
Und vielleicht muss an einer Krise nichts Positives gesehen werden. Sondern daraus gelernt und unsere Gesellschaft nachhaltig verändern werden.
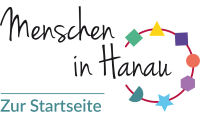






Das ist eine wunderbare Zusammenfassung unserer Diskussion. Danke!
Sie zeigt, dass es an jedem Einzelnen liegt, Veränderungen nachhaltig zu machen durch Gesten, Worte, Wiederholungen – ein Lächeln unter dem Mund-Nasen-Schutz wird leider nicht erkannt!!
Zeigt anderen, dass Ihr etwas verstanden habt. Zeigt, dass wir zusammenhalten.